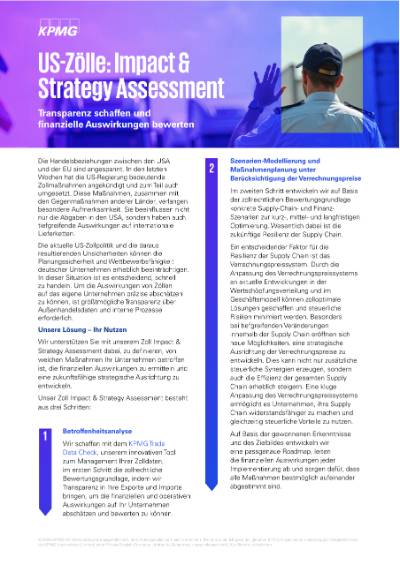Donald Trump hat im Januar 2025 seine zweite Amtszeit als US-Präsident angetreten. Sein Credo bleibt unverändert: „America first“. Die Agenda im Weißen Haus wird von Themen bestimmt, die nach Ansicht der US-Regierung von zentraler Bedeutung für die nationalen Interessen sind.
Seit Amtsantritt hat die Administration zahlreiche präsidiale Dekrete (Executive Orders) erlassen und eine Vielzahl wirtschafts- und handelspolitischer Maßnahmen umgesetzt, die erhebliche Folgen auch für global agierende deutsche Unternehmen haben. Besonders einschneidend war die Ankündigung flächendeckender Importzölle am sogenannten „Liberation Day“.
Nach einer Phase mehrfach verschobener Übergangsfristen und Zollpausen trat am 7. August 2025 ein neues Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union in Kraft. Es sieht für den Großteil der EU-Exporte in die Vereinigten Staaten einen einheitlichen Zollsatz von 15 Prozent vor, der als Obergrenze gilt und nicht mit weiteren Abgaben kombiniert werden darf. Am 21. August veröffentlichten beide Seiten nun einige Details zur Umsetzung. Demnach werden die US-Zölle auf Automobile aus der EU rückwirkend zum Monatsbeginn von zuvor 27,5 auf 15 Prozent gesenkt, sobald die EU ihrerseits den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte einleitet. Auch für die Pharmaindustrie sollen 15 Prozent gelten, wohingegen Stahl und Aluminium voraussichtlich mit 50 Prozent belastet werden. Parallel dazu verpflichtet sich die Europäische Union, ihre Industriezölle vollständig abzuschaffen, Barrieren beim Import ausgewählter Lebensmittel zu senken und in großem Umfang US-Energie zu beziehen sowie zusätzliche Investitionen in den Vereinigten Staaten zu tätigen.
Ergänzend vereinbarten beide Seiten gegenseitige Zollfreiheit für bestimmte Produkte wie Flugzeuge und -teile, Chemikalien, Generika oder Halbleiterausrüstungen. Streitpunkte bleiben jedoch bestehen, etwa bei Wein, Spirituosen und im Digitalbereich, die bislang von den Gesprächen ausgenommen sind. Zudem handelt es sich bei der gemeinsamen Erklärung nicht um ein rechtsverbindliches Abkommen, sodass weiterhin das Risiko einseitiger Schritte der US-Regierung besteht.
Für deutsche Unternehmen bedeutet dies: Es gibt nun mehr Klarheit und erste Begrenzungen bei den Zusatzzöllen, zugleich aber auch weiterhin politische Unsicherheiten und Abhängigkeiten – insbesondere im Energiesektor und bei zukünftigen Handelsgesprächen. Im Endergebnis wird erwartet, dass der durchschnittliche effektive Zollsatz für Exporte aus der EU in die USA in einer Spannbreite zwischen 10 und 14 Prozent liegt – eine deutliche Erhöhung gegenüber den durchschnittlich knapp 2 Prozent vor dem „Liberation Day“.
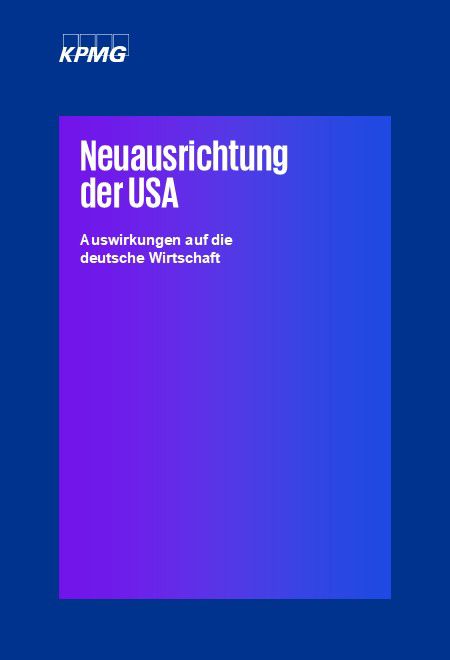
Worauf sich die deutsche Wirtschaft jetzt einstellen sollte
Was plant die neue US-Administration – und wie sollten deutsche Unternehmen reagieren? Hintergründe, Einordnungen, Branchen im Fokus sowie Strategie- und Handlungsempfehlungen kompakt.
Jetzt herunterladenAndreas Glunz
Bereichsvorstand International Business
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Monatliche Webcast-Reihe

Webcast-Live KPMG Briefing : Neuausrichtung der USA, Chancen und Herausforderungen – mit Q&A
Aufzeichnung von Dienstag, 08.07.2025
Jetzt Webcastaufzeichnung ansehen
Themenschwerpunkte und Aufzeichnung vom 08.07.2025
- Verabschiedung des One Big Beautiful (Tax) Bills (OBBB) am 4.7.2025: Dauerhafte Festschreibung zahlreicher steuerlicher Regelungen auf dem aktuellen Niveau, Steuererleichterungen für Investitionen in neue Fabriken in den USA, Abschaffung/Auslaufen des Inflation Reduction Acts (IRA), Neue Section 899 (zunächst) gestrichen, Unwägbarkeiten aus Section 891, Inkrafttreten des OBBB
- US-Zölle: voraussichtliche Verlängerung der 90-Tage-Pause vom 9.7.2025 bis zum 1.8.2025, neu geschlossene US-Zollabkommen und Kernpunkte, Indirekte Auswirkungen der Zölle auf China-EU-Zölle, Verhandlungspunkte zwischen USA und EU, Prognose des Verhandlungsergebnisses; Chance für Zolleinsparungen; Automatisierte Zoll-Tarifierungsprüfung mittels KPMG Trade Data Check; KPMG Tariff Simulator für Modellierung Zoll-Zusatzbelastungen, De-Minimis-Regeln, Rechnungs-Split in Haupt- und Nebenleistungen
- Auswirkungen der Zölle auf Finanzberichterstattung: Wertbegründung vs. Wertaufhellung; Stichtage für Jahres- und Zwischenabschlüsse, Relevanz Rechnungslegungsstandards, Prognoserechnungen mit Szenario-Analysen, Auswirkungen auf Prognose Fortführungsprognose, Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten
- US-Steuerreform: „The One Triple B Act”/„The One Big Beautiful Bill Act”; Steuerverschiebung statt Steuerminderungen: keine 15% Corporate Tax Rate; Phase-out Inflation Reduction Act; Retaliatory measures; Section 899; Unfair Foreign countries; Handlungsempfehlungen für deutsche Konzernmütter, US-amerikanische Töchter und Betriebsstätten sowie US-Secondees; BEAT/Mindeststeuer in den USA
- Zölle: Stand der Handelsabkommen UK, China, Indien und EU; Umgang der US-Konzerne mit Zusatzzöllen: „Eat the Tariffs“ vs. Preiserhöhungen und „Pre-tariff Memorial sales“; Handlungsempfehlung Anpassung Transferpreise; „Reconciliation program“ für Zoll-Korrekturen in den USA; Sicherheitsleistungen an Broker
- Befragungsergebnisse deutscher Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in den USA
- US-Zölle: Kategorien von US-Zöllen, Reziprozität der US-Zölle, Auswirkung der bereits gültigen 10% reziproker Zölle, Wahrscheinlichkeit für TTIP 3.0, Kombination verschiedener Zoll-Arten, Zollausnahmen, KPMG Tariff Modeller, USMCA-goods, Zollminderungsstrategien
- Digitalsteuern: Motivation, Diskussionsstand, Anwendungsbereiche, Zeitscheine und Wirkung auch auf deutsche Tech-Unternehmen
- US-Steuerreform: Steuersenkungen vs. Steuererhöhungen für deutsche Unternehmen in den USA, Körperschaftsteuersatzsenkung auf 15%; Tax credits, 50% withholding taxes, Estes Act (BEAT), zeitlicher Fahrplan der Gesetzgebungsverfahren
- US-Zusatzzölle:
- Zoll-Simulationen
- Entfallende Zollrückvergütungen
- Zölle bei Vorerwerbergeschäften
- Produktspezifische Zollaussetzungen
- „Local content“-Vorschriften
- „Completely Knocked down“-Gestaltungen
- Lieferketten:
- Incoterm-Relevanz
- Lagerbestandsaufbau in den USA
- Konsignationsläger in den USA
- Lieferketten-Umbau/“Local sourcing“ in den USA
- Steuerung operativer Prozesse
- Produktionsstätten in den USA
- Verrechnungspreise:
- Relevanz Lieferkettenanpassungen auf Verrechnungspreismodelle
- Zollwertreduktionen
- Exit-Taxation
- Technische Herausforderungen
- Steuergesetzänderungen in den USA:
- Bindungswirkung der „executive orders/actions“
- „Budget reconciliation process“ in USA /Timeline für Gesetzesänderungen
- „Trump´s big beautiful tax bill“
- „Tax cliff“
- Erwartete Steuererhöhungen bei ausländischen Unternehmen
- Digitale Strategien im transatlantischen Korridor:
- Ende des “EU-US Data Privacy Agreements”?
- Cloud-Strategien
- Digitale Resilienz
- Redundanzen
- Nutzung US-AI-Tools (ChatGPT, …) und US-ERP-Solutions in Europa
- Strafzölle vs. Ausgleichszölle
- Verlagerung von Lieferketten und Produktionsstätten
- Lageraufbau in den USA
- Gesetzl. Umsetzung von Zusatzzöllen, betroffene Produkte und Länder
- De-Minimis-Regel
- Mehrwertsteuern als Handelshemmniss
- Ausblick auf Steuergesetzänderungen in USA
- Verschuldungssituation USA
- Tax cliff
- Ausstieg aus globaler Mindestbesteuerung
- neue Quellensteuerabzugsbesteuerung in USA
- Abweichende AI- und ESG-Regeln in USA und Europa
- Zukünftige Nutzung US-amerik. AI-Modelle in Europa
- Relevanz CSRD für US-Gruppen in Deutschland
- Positionierung zu Diversity-, Inclusion- und Equity-Programmen in den USA
Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Auswirkungen der Neuausrichtung der USA auf deutsche Unternehmen
Donald Trump beginnt im Januar 2025 seine zweite Amtszeit als US-Präsident. Sein Credo bleibt „America first“. Das bedeutet, dass die Agenda im Weißen Haus von den Themen dominiert wird, die nach Ansicht von Trump elementar für die nationalen Interessen sind. Die anvisierte wirtschaftspolitische Neuausrichtung in Washington kann für deutsche Unternehmen besonders folgenreich sein. Womit ist zu rechnen? Welche Vorbereitungsmaßnahmen gilt es jetzt schon zu treffen? Und wie sollten Unternehmen ihre Strategie anpassen, um weiterhin erfolgreich auf dem US-Markt agieren zu können? Wir zeigen die wichtigsten Details auf, kompakt und präzise.
Donald Trump will den Standort USA stärken, indem er Unternehmenssteuern senkt und den nationalen beziehungsweise regionalen Markt für importierte Waren aus dem Ausland unattraktiver macht. Drastische protektionistische Maßnahmen auf Kosten langjähriger Handelspartner wie Deutschland sind wahrscheinlich. Außerdem plant Trump, diverse Sektoren, darunter den Energie- und Finanzsektor, zu deregulieren und ESG-Verpflichtungen auszusetzen.
15,7 Milliarden Euro haben deutsche Unternehmen im Jahr 2023 in den USA direkt investiert. Im Jahr zuvor waren es noch 8,2 Milliarden Euro. Ausschlaggebend für den Anstieg war der Inflation Reduction Act (IRA), ein Maßnahmenpaket der Biden-Administration zur Förderung klimafreundlicher Technologien. Deutsche Unternehmen waren für ihr USA-Geschäft bis zuletzt sehr zuversichtlich. In welcher Form der IRA unter Trump Bestand hat, ist äußerst fraglich.
Die angekündigten Unterstützungsmaßnahmen für die amerikanische Wirtschaft werten den Standort auf. Der Spitzensteuersatz für Unternehmen wurde in Trumps erster Amtszeit bereits von 35 auf 21 Prozent gesenkt. Nun stellte er Unternehmen, die in den USA produzieren, eine weitere Senkung auf 15 Prozent in Aussicht, während Importe massiv verteuert werden. Gleichzeitig könnte eine rigidere Migrationspolitik – ebenfalls angekündigt – den Fachkräftemangel verstärken.
Änderungen oder gar eine Aussetzung des IRA würden die nachhaltige Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft verlangsamen: Förderungen für erneuerbaren Energien fallen weg, „grüne“ Projekte könnten nicht mehr steuerlich begünstigt werden. Erdöl- und Erdgasprojekte werden unterdessen lukrativer. Zu erwarten ist außerdem, dass Technologieinvestitionen erheblich ansteigen, da etliche staatliche Einschränkungen wahrscheinlich wegfallen werden.
Donald Trump plant nicht zuletzt wegen des konstant hohen US-Handelsbilanzdefizits mit der EU die flächendeckende Einführung von Importzöllen in Höhe von 10 bis 20 Prozent. Sollte die EU auf die neuen finanziellen Hürden mit Vergeltungszöllen auf US-Importe antworten, würde Trump eigenen Aussagen zufolge sofort nachlegen: Sogar Zölle in Höhe von mehr als 100 Prozent seien denkbar. Das könnte einen eskalierenden Wettlauf von Handelsbeschränkungen auslösen, der auch dem Standort USA schaden wird.
Neue US-Zölle könnten laut Analysteneinschätzungen zu einem Wirtschaftsrückgang von 1 bis rund 1,5 Prozent in Deutschland führen. Eine Rezession wäre dann unausweichlich. Möglich ist zudem, dass US-Unternehmen geplante Investitionen in Deutschland zurückstellen oder ganz unterlassen, da sich die Rahmenbedingungen auf dem Heimatmarkt verbessern. Deutschland ist für US-Investitionen in eher traditionellen Industrien aktuell bereits kein priorisierter Standort mehr und die Relevanz könnte noch einmal sinken. Anders ist dies aber hinsichtlich neuer Geschäftsfelder, die in Anbetracht der großen Transformationen in Deutschland entstehen. Hier fanden zuletzt gerade aus den USA Milliarden-Euro-schwere Greenfield-Investitionen in Data Center, Microchip-Fabriken und hochmoderne Produktionsstätten für pharmazeutische Produkte statt.
Es ist jetzt essenziell, exportlastige US-Geschäftsstrategien zu überprüfen. Geschäftsmodelle, die beispielsweise ausschließlich auf dem Warenexport in die USA basieren, könnten künftig die Wettbewerbsfähigkeit massiv einschränken. Um den Zugang zum US-Markt zu kompetitiven Preisen zu sichern, kann der Aufbau von Produktionskapazitäten vor Ort erforderlich werden. Die Wertschöpfungskette sollte weiter regionalisiert werden – aber auch Desinvestitionen könnten sinnvoll werden.
China ist besonders im Visier von Trump. Er unterstellt der wachsenden Großmacht unfaire Wirtschaftspolitik auf Kosten der USA. Es ist nicht auszuschließen, dass Trump das Aufrechterhalten derzeitiger Handelsverflechtungen zwischen den USA und Europa an die EU-Gefolgschaft im Engagement gegen chinesische Produktions- und Exportstärke koppelt. China ist für deutsche Unternehmen wiederum von ebenso großer Bedeutung wie die USA und ein Verzicht auf einen der beiden Märkte keine Option.
Donald Trump hat die Mittel, um auch weitreichende Maßnahmen umzusetzen, denn sowohl das US-Repräsentantenhaus als auch der US-Senat sind ab 2025 unter republikanischer Führung. Zudem ist er jetzt besser vorbereitet als bei seiner erstmaligen Wahl. Es ist deswegen denkbar, dass schnell strukturelle, tiefgreifende Veränderungen vorgenommen werden, die nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit auch nur mit großen Mühen rückabgewickelt werden können. Das von einer protektionistischen Weltanschauung geprägte Umlenken weltweiter über Jahrzehnte gewachsener Handelsströme hätte besonders für die exportorientierte deutsche Wirtschaft schwerwiegende langfristige Konsequenzen.
Wie kann KPMG helfen?
Unsere interdisziplinären Teams, bestehend aus Expert:innen aus den Bereichen Trade & Customs, Performance & Strategy und Finanzen bieten Ihnen umfassende Unterstützung.