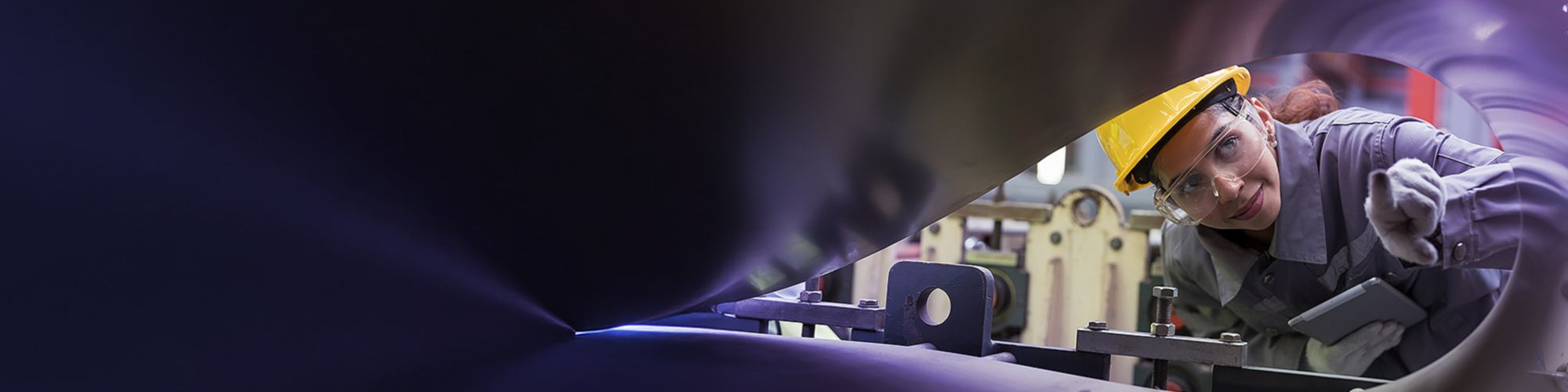Aktuelle Lage
Seit dem 5. April erheben die USA auf sämtliche Importe einen pauschalen Basiszoll von 10 Prozent – zusätzlich zum Regelzollsatz, der je nach Produktkategorie unterschiedlich hoch ist und für viele Industriegüter bislang 0 Prozent betrug. Präsident Donald Trump hatte außerdem angekündigt, für Länder mit einem besonders großen Handelsdefizit gegenüber den USA – darunter die Europäische Union – spezifische Zusatzzölle zu erheben. Für die EU war ein Aufschlag von 20 Prozent vorgesehen, für andere Länder teils noch höhere. Eigentlich wäre dieser Mechanismus seit dem 9. April aktiv gewesen, wurde aber kurzfristig für 90 Tage ausgesetzt.
Vor dem 5. April 2025 waren im gewerblichen Bereich viele Waren, etwa aus dem Bereich der Maschinen und Apparate sowie der elektrotechnischen Waren (Kapitel 84 und 85 des internationalen Zolltarifs), zollfrei. Mit dem neuen Basiszoll gilt nun jedoch für alle Importe mindestens ein Zollsatz von 10 Prozent, der auf den bestehenden Regelzollsatz aufgeschlagen wird.
Unverändert in Kraft bleiben die bereits bestehenden Sonderregelungen, insbesondere die Zusatzzölle von 25 Prozent auf Stahl, Aluminium, Autos und Autoteile. Für Pkw aus der Europäischen Union steigt der Zollsatz damit beispielsweise von bisher 2,5 Prozent (Regelzollsatz) auf nunmehr 27,5 Prozent. Bei Pick-ups und leichten Nutzfahrzeugen klettert er sogar von 25 auf 50 Prozent.
Serjoscha Keck
Partner, German Head of Industrial Manufacturing, Regionalleiter Tax Nord – Hannover
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft
Als exportorientierte Volkswirtschaft spürt Deutschland diese protektionistischen Maßnahmen besonders deutlich. Die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen sind für deutsche Unternehmen von zentraler Bedeutung: Die USA sind Deutschlands wichtigster Handelspartner. Der bilaterale Warenaustausch erreichte 2024 ein Volumen von circa 253 Milliarden Euro, wobei deutsche Ausfuhren etwa 161 Milliarden Euro ausmachten – rund ein Zehntel der gesamten deutschen Exportleistung.
Auswirkungen auf die deutsche Fertigungsindustrie
Besonders betroffen ist der deutsche Maschinenbausektor: Im vergangenen Jahr beliefen sich dessen Lieferungen in die USA auf 27,4 Milliarden Euro – mehr als 13 Prozent der gesamten Branchenexporte. Modellrechnungen für den ausgesetzten 20-Prozent-Zusatzzoll legen einen Rückgang der Ausfuhren in die USA um etwa 15 Prozent nahe, was das deutsche Bruttoinlandsprodukt um schätzungsweise 0,3 Prozentpunkte mindern könnte. Die Marktirritationen betreffen nahezu alle exportorientierten Sektoren, besonders jedoch den Maschinen- und Fahrzeugbau.
Die US-Zollpolitik enthält allerdings Ausnahmen und Sonderregelungen: Für bestimmte Produktkategorien wie Automobil-, Stahl- und Aluminiumerzeugnisse gelten die bereits erwähnten speziellen Zusatzzölle. Darüber hinaus bleiben Produktgruppen wie Kupfer, pharmazeutische Produkte, Halbleiter, Holzwaren und strategische Mineralien vorerst verschont. Die US-Administration
hat jedoch bereits angedeutet, dass diese Ausnahmeregelungen nur temporären Charakter haben könnten.
Für den Stahl- und Aluminiumsektor wurde im März 2025 ein separates Zollregime mit einem einheitlichen Satz von 25 Prozent (zusätzlich zum Regelzollsatz) implementiert, der auch Lieferanten aus Großbritannien, Australien und nordamerikanischen Nachbarstaaten betrifft. Der Regelzollsatz für Stahlprodukte beträgt 0 Prozent, für Aluminiumprodukte liegt der Regelzollsatz zwischen 0 Prozent und 6,5 Prozent.
Eine bemerkenswerte Regelung bietet hingegen einen potenziellen Vorteil: Bei Produkten mit einem Wertschöpfungsanteil aus den USA von mindestens 20 Prozent werden die erhöhten Zollsätze nur auf den ausländischen Wertanteil erhoben.
Deutsche Unternehmen stehen vor der komplexen Aufgabe, ihre US-Marktstrategien anzupassen und gleichzeitig ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend protektionistischen Umfeld zu sichern.
Ein weiteres Risiko: eine mögliche Handelsablenkung. Da nahezu alle globalen Handelspartner der USA mit Zöllen konfrontiert sind, könnten ursprünglich für den US-Markt bestimmte Warenströme – insbesondere aus asiatischen Ländern – verstärkt nach Europa umgeleitet werden und hier den Wettbewerbsdruck erhöhen.
Das direkte Exportvolumen von deutschem Stahl in die USA ist relativ gering – es liegt bei etwa einer Million Tonnen bei einer heimischen Jahresproduktion von rund 37 Millionen Tonnen, daher richten sich die Bedenken der Stahlbranche eher auf die indirekten Folgen: Umgeleitete asiatische Exportmengen könnten den europäischen Markt destabilisieren.
Handlungsoptionen für deutsche Unternehmen
Die veränderten Rahmenbedingungen eröffnen auch strategische Möglichkeiten für deutsche Anbieter. So könnte ein relativer Wettbewerbsvorteil entstehen, da Konkurrenten aus China (Zollsatz von mehr als 100 Prozent), Südkorea (25 Prozent) oder Japan (24 Prozent) mit höheren Zollbelastungen konfrontiert sind als Produkte aus Deutschland mit 20 Prozent.
Trotz der US-Dominanz in bestimmten Hightech-Sektoren bleibt die deutsche Industrie im klassischen Maschinenbau weiterhin führend. Für die von der US-Administration angestrebte Reindustrialisierung werden hochwertige Produktionsanlagen benötigt – ein Feld, auf dem deutsche Anbieter traditionell stark sind.
Deutsche Fertigungsunternehmen sollten eine mehrstufige Strategie verfolgen: kurzfristig empfiehlt sich die Integration von US-Komponenten, um von der 20-Prozent-Regelung zu profitieren, sowie die Neuverhandlung bestehender Lieferverträge. Mittelfristig sollten sie die Verlagerung bestimmter Produktionsschritte in die USA prüfen, um Zollbarrieren zu umgehen. Langfristig ist eine geografische Diversifizierung der Absatzmärkte ratsam, kombiniert mit der konsequenten Weiterentwicklung von Premiumlösungen, bei denen nicht der Preis, sondern technologische Überlegenheit und verlässliche Qualität im Vordergrund stehen.
Branchenspezifisch lassen sich verschiedene Handlungsansätze identifizieren:
Maschinenbau
- Evaluieren von Produktionsverlagerungen in die USA unter Berücksichtigung herausfordernder Faktoren wie Fachkräftequalifikation und lokalen Zulieferstrukturen.
- Strategische Integration von US-Komponenten zur Nutzung der 20-Prozent-Zollerleichterung.
- Betonung deutscher Qualitäts- und Innovationsführerschaft gegenüber amerikanischen Abnehmern, die für ihre Fertigungsprozesse weiterhin auf Spitzentechnologie angewiesen sind.
Stahlindustrie
- Geographische Diversifizierung der Absatzmärkte zur Reduktion der US-Abhängigkeit.
- Für Unternehmen mit bestehender US-Fertigung: Kapazitätsausbau vor Ort.
- Fokus auf Premiumsegmente und Speziallösungen mit geringerer Preissensitivität.
Allgemeine Strategien
- Detaillierte Analyse der Zollbestimmungen unter Einbeziehung externer Handelsexperten.
- Optimieren internationaler Wertschöpfungsketten unter Berücksichtigung der neuen Zollarchitektur.
- Kontinuierliches Monitoring der handelspolitischen Entwicklungen und diplomatischen Bemühungen.
- Unterstützen der europäischen Verhandlungsinitiativen für eine kooperative Lösung des Zollkonflikts.