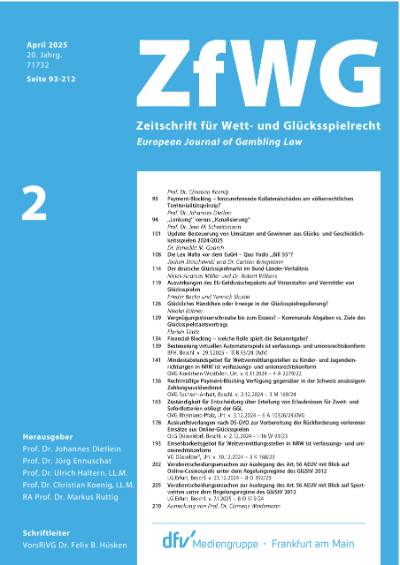Der Jahresreport der Glücksspielaufsichtsbehörden beziffert das Volumen der im Jahr 2022 erwirtschafteten Bruttospielerträge auf 12,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Glücksspielsektor somit um mehr als ein Drittel gewachsen. Gut 80 Prozent der Erträge wurden dabei im stationären Spiel erwirtschaftet. Die Branche besteht zu ungefähr gleichen Teilen aus den Segmenten der Geldspielgeräte, der staatlichen Lotterien sowie Spielbanken, Sportwetten und sonstige Lotterien.
Die Nationale Risikoanalyse der Bundesrepublik Deutschland bewertet das Geldwäscherisiko des Glücksspielsektors als hoch. Die Bewertung stützt sich auf die häufig hohen Transaktionsbeträge und die hohe Geschwindigkeit, mit der Gelder umgeschlagen werden. Die Financial Action Task Force entwickelte bereits in ihrem Bericht über Schwachstellen des Glücksspielsektors aus dem Jahr 2009 diverse Typologien für das terrestrische Spiel mit Fokus auf Kasinos. Demnach erbringen Kasinos per se risikobehaftete finanzielle Aktivitäten, beispielsweise die Annahme von Guthaben auf Rechnung und die Durchführung von Geldtransfers. Ein besonderes Risiko stellt die Bargeldintensität des physischen Spielbetriebes dar.
Seit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages am 1. Juli 2021 sind bisher verbotene Online-Spiele unter bestimmten Voraussetzungen erlaubnisfähig. Auf dieser Grundlage wurden bis Oktober 2023 bereits 78 Erlaubnisse für virtuelle Automatenspiele, Online-Casinospiele und Online-Poker erteilt. Insofern ist zukünftig von einem Bedeutungsgewinn des legalen Online-Glücksspiels auszugehen. Im Online-Spiel bestehen zudem Risiken aufgrund der vielfältigen Zahlungsmöglichkeiten, einschließlich der Zahlung mit Kryptowerten. Diese Methoden eignen sich zur Verschleierung der Identität des Spielers sowie der Herkunft der eingesetzten Vermögenswerte.
Ausweislich des FIU-Jahresberichts waren zum Stichtag 31. Dezember 2022 circa 1.550 Anbieter und Vermittler von Glücksspielen im Meldeportal registriert. Weniger als 6 Prozent der registrierten Unternehmen waren im Betrachtungszeitraum aktiv und erstatteten in Summe 462 Verdachtsmeldungen. Damit kommt der Glücksspielsektor trotz seiner relativen Größe und herausgehobenen Risikolage auf nur 0,1 Prozent der insgesamt erstatteten Verdachtsmeldungen. Lediglich im Periodenvergleich zeigt sich eine positive Entwicklung: Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Meldequote mehr als verdoppelt.
Geldwäscherisiken im Glücksspielsektor
Das Missbrauchsrisiko ist nicht in allen Teilbereichen des Glücksspielsektors gleichermaßen ausgeprägt. Besonders anfällig sind Spiele, deren Ausgang durch kriminelle Aktivitäten bestimmt werden kann. In Betracht kommen gezielte Spielmanipulationen wie Hacking im Online-Bereich oder das Beeinflussen der Ergebnisse von Sportveranstaltungen. Die Ausgestaltung der Sicherungsmaßnahmen ist ein weiterer Faktor. Beispielsweise können Geldwäscher durch das Korrumpieren von Angestellten des Spielbetreibers bestehende Kontrollen aushebeln. Immer wenn Kriminelle das Verlustrisiko auch ohne direkte Manipulation des Spielresultats beeinflussen können, sind Spiele für Geldwäsche geeignet. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn Geldwäscher simultane Wetten eingehen oder im direkten Wettbewerb mit anderen Spielern bewusst zu Gunsten ihrer Mitverschwörer verlieren.
Barbara Scheben
Partner, Audit, Regulatory Advisory, Head of Forensic, Head of Data Protection
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Niclas-Andreas Müller
Director, Audit, Regulatory Advisory, Forensic
KPMG in Ireland
Darüber hinaus ist das Nutzen fremder Spielerkonten, sogenanntes Strohmanngeschäft, zum Waschen inkriminierter Vermögenswerte ein gängiges Muster. Häufig nehmen diese Strohmänner nicht oder nur in begrenztem Rahmen am Spiel teil und verlangen anschließend die Auszahlung des Guthabens, den sie als Gewinne aus Glücksspielen deklarieren. Geringfügige Verluste nehmen die Geldwäscher dabei bewusst in Kauf. Alternativ erwerben Geldwäscher einen legal angefallenen Gewinnausschüttungsanspruch von einem regulären Spieler und nutzen diesen Vorgang zur Legalisierung inkriminierter Barmittel.1
Ein spezifisches Risiko ergibt sich auch aus der teilweisen Unterwanderung der Branche durch kriminelle Organisationen, insbesondere im Bereich der sogenannten Clan-Kriminalität. Von solchen Strukturen kontrollierte Spielstätten bieten die Möglichkeit zum direkten Einschleusen inkriminierter Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf sowie der Planung weiterer krimineller Handlungen.
Aktuelle Rechtslage
Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (kurz Geldwäschegesetz) verpflichtet Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen dazu, Maßnahmen zum Verhindern von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Unter Glücksspiel versteht man jedes Spiel, bei dem ein Spieler für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt entrichtet, und der Eintritt von Gewinn oder Verlust ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Ausgenommen sind derzeit Betreiber von Geldspielgeräten mit gewerberechtlicher Erlaubnis2, Betreiber von Totalisatoren3 sowie Lotterien, die von der zuständigen Behörde zugelassen sind.
Grundsätzlich haben Glücksspielanbieter die im Geldwäschegesetz festgelegten Anforderungen vollumfänglich einzuhalten. Eine Erleichterung sieht der Gesetzgeber für den niedrigschwelligen, terrestrischen Spielbetrieb vor. Demnach müssen Verpflichtete die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen in Form von Gewinnen oder Einsätzen eines Spielers erst ab einem Betrag von 2.000 Euro erfüllen. Ausgenommen hiervon sind online-basierte Glücksspiele.4 In der Praxis wird dieser Anforderung durch eine Zutrittskontrolle zur Spielstätte nachgekommen. Aufgrund des hohen Geldwäscherisikos müssen Glücksspielanbieter die Dokumente, Daten und Informationen über ihre Vertragspartner und die Geschäftsbeziehung in jährlichem Turnus aktualisieren. Die Anwendung von vereinfachten Sorgfaltspflichten kommt im Glücksspielbereich grundsätzlich nicht in Betracht.
Zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen für alle Verpflichteten fallen Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen im Internet unter weitergehende Vorschriften. Hierzu gehört unter anderem das Einrichten eines namentlich zugeordneten Spielerkontos, das Verbot der Entgegennahme und Verzinsung von Einlagen sowie die Einschränkung der erlaubten Transaktionstypen. Dazu zählt insbesondere das Verbot von Krypto-Transfers. Wie auch Kreditinstitute müssen Glücksspielanbieter ein Datenverarbeitungssystem betreiben und aktualisieren, mittels dessen sie in der Lage sind, zweifelhafte oder ungewöhnliche Geschäftsbeziehungen sowie einzelne Transaktionen im Spielbetrieb oder über ein Spielerkonto zu erkennen. Ausweislich der gemeinsamen Hinweise der Obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder (Stand: November 2020) dürfen Spielbanken jedoch unter bestimmten Voraussetzungen von dieser Pflicht absehen.
Die EU-Geldwäschenovelle
Die Europäische Union hat am 30. Mai 2024 ein umfassendes Geldwäschepaket verabschiedet. Das Kernelement dieser Novelle ist die Geldwäscheverordnung. Damit werden die materiellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention erstmals ohne weitergehende nationale Umsetzungsakte innerhalb der gesamten Union einheitlich und unmittelbar anwendbar. Die Verordnung gilt auch für Anbieter von Glücksspieldiensten, jedoch mit bestimmten Ausnahmen.
Demnach erhalten die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, Anbieter von Glücksspieldiensten ganz oder teilweise von geldwäscherechtlichen Anforderungen auszunehmen, wenn von der Art und dem Umfang ihrer Tätigkeit ein nachgewiesen geringes Risiko ausgeht. Diese Erleichterung greift nicht für Kasinos, die in jedem Fall Maßnahmen zur Geldwäscheprävention ergreifen müssen. Anbieter von Online-Glücksspielen dürfen befreit werden, sofern sie staatlich betrieben werden oder reguliert sind. Voraussetzung: Es muss eine spezifische Risikobewertung durch-geführt, die Ausnahme der EU-Kommission angezeigt und von dieser genehmigt werden.
Die neuen Anforderungen im Überblick
Der bisherige Schwellenwert in Höhe von 2.000 Euro für die Anwendung der allgemeinen Sorgfaltspflichten bleibt unverändert bestehen. Zudem ist die dem Spielbetrieb vorgelagerte Identifizierung der Vertragspartner in Form einer Zutrittskontrolle weiter möglich. Die bisher zusätzlich bestehenden Anforderungen an das EDV-Monitoring und die besonderen Vorschriften für das Glücksspiel im Internet fehlen hingegen im Verordnungstext. Ob hierdurch eine praktische Teilentpflichtung der Branche erfolgen wird oder ob diese zusätzlichen Anforderungen in weitergehende Umsetzungsakte aufgenommen werden, bleibt vorerst abzuwarten. Jedenfalls müssen die bisherigen Maßnahmen bis zum Geltungsbeginn der neuen Verordnung unverändert fortgeführt werden.
Neben den Anforderungen an das Verhindern von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen Glücksspielanbieter künftig auch Maßnahmen hinsichtlich des Nichtumsetzens oder Umgehens von gezielten finanziellen Sanktionen ergreifen.
Hierfür erweitert der Regelungsgeber unter anderem die folgenden geldwäscherechtlichen Pflichten um eine sanktionsspezifische Komponente. Dazu gehören
- das Durchführen einer unternehmensweiten Risikoanalyse,
- das Schaffen interner Strategien, Verfahren und Kontrollen,
- das Einrichten einer Compliance-Funktion und
- das Prüfen von Kunden und wirtschaftlichen Eigentümern.
In der Praxis können Unternehmen ihren neuen Prüfpflichten durch den Abgleich von Datensätzen, die zur Identifizierung der Spieler aufgenommen werden, mit einschlägigen Sanktionslisten nachkommen. Diese Prüfung sollte vor Aufnahme des Spielbetriebs erfolgen und im Verlauf der Geschäftsbeziehung periodisch sowie anlassbezogen - beispielsweise bei Erlass neuer Sanktionen - wiederholt werden.
Ausblick und Handlungsbedarf
Die Geldwäscheverordnung gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten. An verschiedenen Stellen verweist die Verordnung auf technische Regulierungs- und Umsetzungsstandards, die noch von der neuen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering Authority, kurz AMLA) zu erarbeiten sind. Diese Standards sollen die geldwäscherechtlichen Pflichten spezifizieren. Darüber hinaus ist eine umfassende Überarbeitung der Verwaltungspraxis der Obersten Aufsichtsbehörden der Länder für den Glücksspielsektor zu erwarten.
Ungeachtet dieser noch anstehenden Änderungen sollten sich Glücksspielanbieter bereits frühzeitig mit den neuen Vorschriften beschäftigen und deren Auswirkung auf ihr bestehendes Risikomanagementsystem im Rahmen einer Gap-Analyse ausloten.
Die Expertinnen und Experten von KPMG stehen Ihnen bei allen Fragen rund um die Geldwäscheprävention gern zur Verfügung.
1 Vgl. FIU-Typologiepapier, Besondere Anhaltspunkte für die Glücksspielbranche (Stand: März 2018).
2 Vgl. § 33c Gewerbeordnung.
3 Vgl. § 1 Rennwett- und Lotteriegesetz.
4 Vgl. § 10 Abs. 5 Geldwäschegesetz..