Die Energiewirtschaft in Deutschland verändert sich grundlegend – und das mit hoher Geschwindigkeit. Für Industrieunternehmen bedeutet das: steigende Komplexität, wachsendes Risiko und zunehmender Handlungsdruck. Strommärkte sind durch den starken Zubau volatiler Erzeuger wie Photovoltaik und Windkraft unberechenbarer geworden. Die Folge: schwankende Preise, negative Strompreise in Spitzenstunden und sinkende Planungssicherheit. Gleichzeitig fordert die Politik ambitionierte System- und Dekarbonisierungsziele, die Unternehmen mittragen sollen – und müssen.
In diesem Umfeld wird deutlich: Energie ist nicht länger nur Betriebskostenfaktor, sondern strategische Weichenstellung. Unternehmen, insbesondere solche mit energieintensiven Prozessen, sind gefordert, ihre Rolle neu zu denken – als aktive Marktteilnehmer, nicht als passive Verbraucher.
Was energieintensive Unternehmen derzeit bremst
Viele Unternehmen kämpfen mit starrem Energiebezug, fehlender Markttransparenz und unzureichender Verzahnung von Energieverbrauch und -erzeugung mit dem Einkauf. Häufig bestehen mehrjährige Lieferverträge mit festen Preisen und Risikozuschlägen, ohne Anbindung an aktuelle Marktchancen. Eigene PV-Anlagen oder teils auch bestehende Energiespeicher bleiben ungenutzt oder schlecht integriert. Zudem fehlt es oft an Handelskompetenz, etwa im Umgang mit Sicherungsgeschäften oder Tranchenbeschaffung.
Diese Situation verschärft sich durch regulatorische Unsicherheiten – etwa bei der langfristigen Ausgestaltung der Netzentgelte oder der Rolle von sogenannten Kundenanlagen. Der Zugang zu wettbewerbsfähiger Energieversorgung droht so für viele Unternehmen zum Engpass zu werden – meist ohne, dass Unternehmen dies merken.
Die Lösung: Aufbau einer internen Energiegesellschaft
Ein vielversprechender Ausweg liegt im Aufbau einer unternehmenseigenen Energieeinheit – etwa in Form einer zentralen Energiegesellschaft. Diese übernimmt alle strategischen und operativen Energieaufgaben: von der Beschaffung über die Direktvermarktung bis hin zur Flexibilitätsnutzung und dem Energiemanagement.
A. Effizienzsteigerung und Kostenreduktion
Durch das Bündeln von Energiethemen in einer spezialisierten Einheit können Unternehmen
- eigene Erzeugungsanlagen wirtschaftlich optimal nutzen,
- Flexibilitätspotenziale gewinnbringend vermarkten,
- aktiv an Spot- und Intradaymärkten teilnehmen und,
- ihre Energiekosten mittel- bis langfristig senken.
Keywan Ghane
Partner, Performance & Strategy
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Thomas Künzel
Senior Manager, Performance & Strategy, Enterprise Performance
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wer mehrere Standorte gemeinsam steuert, kann von Größenvorteilen profitieren und den Energieeinsatz im Unternehmen insgesamt effizienter koordinieren. Zwar sind Investitionen in IT, Know-how und Governance nötig – sie zahlen sich durch sinkende Abhängigkeiten von externen Versorgern jedoch schnell aus.
B. Flexibilität als neues Geschäftsmodell
Moderne Energiegesellschaften sind mehr als nur Kostenoptimierer – sie erschließen neue Erlösquellen. Batteriespeicher, Vehicle-to-Grid-Konzepte und Power-to-X-Anwendungen machen Unternehmen zu aktiven Playern im Energiesystem. Der eigene Aggregator innerhalb der Energiegesellschaft kann so Regelenergie- und Intraday-Märkte gezielt nutzen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Dies muss dabei nicht zwingend durch eigene Trading Desks erfolgen, kann aber aus einer zentralen Energieeinheit erstmalig effizient und gewinnbringend an externe Dienstleister vergeben werden.
Zudem können strategisch eingesetzte Speicher Erzeugungs- und Verbrauchsspitzen entkoppeln – ein echter Wettbewerbsvorteil in einem volatilen Marktumfeld.
Vorteile vs. Herausforderungen – ein klarer Blick auf die Optionen
Vorteile
- Planbarkeit und optimierte Energiebeschaffung
- Neue Ertragsquellen durch Flexibilitätsvermarktung,
- Technologische Modernisierung und Infrastrukturaufbau
- Beitrag zur Versorgungssicherheit und Systemstabilität
Herausforderungen
- Aufbau regulatorischer und IT-Expertise
- Umgang mit Marktvolatilität und regulatorischer Komplexität
- Veränderungsmanagement und interne Governance
- Notwendigkeit kultureller Transformation
Handlungsempfehlungen für die Praxis
- Struktur schaffen:
Starten Sie mit einem klaren Konzept zur Gründung einer internen Energiegesellschaft. Definieren Sie Schnittstellen zu Einkauf, IT, Controlling und Compliance. - Potenziale analysieren:
Erfassen Sie die Daten Ihrer bestehenden und geplanten Energieanlagen und Speicher. Entwickeln Sie eine technische und wirtschaftliche Bewertungsmatrix. - Technologie integrieren:
Setzen Sie auf ein zentrales Energiedatenmanagement („virtuelles Kraftwerk“) und prüfen Sie die Möglichkeit automatisierter Marktschnittstellen. Smart Metering, Batteriespeicher und Vehicle-to-Grid müssen intelligent miteinander vernetzt sein. - Märkte aktiv nutzen:
Prüfen Sie Kooperationen mit Aggregatoren oder entwickeln Sie schrittweise eigene Handelskompetenz. Nehmen Sie so aktiv an Regelenergie-, Intraday- und Spotmärkten teil. - Governance und Kompetenz aufbauen:
Verankern Sie Energie in Ihre KPI-Systeme, bauen Sie internes Wissen auf und etablieren Sie Compliance- und Reportingstrukturen.
Fazit: Energie wird zum strategischen Aktivposten
Die Energiewende ist nicht nur eine technologische, sondern auch eine strategische Herausforderung. Wer als Unternehmen in Eigenverantwortung handelt, kann nicht nur Risiken minimieren, sondern Chancen aktiv gestalten.
Weitere Einblicke zum globalen Wandel der Energieökonomie:
The electricity economy – Electricity as the new driver of global competitiveness
Publikationen
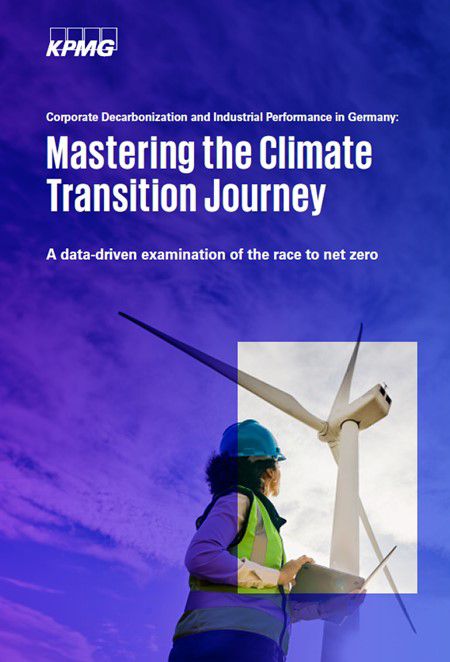
Studie jetzt herunterladen
Dekarbonisierung der deutschen Industrie: Chancen und Hürden
Jetzt herunterladen





