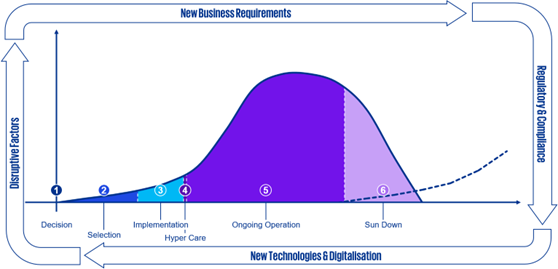Wenn Sie sich für das passende TMS entschieden haben, gilt es im nächsten Schritt dieses zu implementieren. Eine erfolgreiche Systemeinführung erfordert eine sorgfältige Planung, eine klare Projektorganisation und die Einbindung aller relevanten Stakeholder. Eine gut strukturierte Projektorganisation schafft die Grundlage für eine effektive Zusammenarbeit und Kommunikation. Gleichzeitig ist es wichtig, die Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder zu identifizieren und sicherzustellen, dass sie während des gesamten Projekts berücksichtigt werden.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Wahl des Projektmanagement-Ansatzes auf Basis der spezifischen Projektanforderungen. Dieser bildet die Grundlage und setzt gleichzeitig die Rahmenbedingungen für den gesamten Projektverlauf. Während Agilität Flexibilität und schnelle Anpassungen ermöglicht, bietet der Wasserfall-Ansatz klare Phasen und Struktur. Ein ausschlaggebender Punkt in der Entscheidung ist die unternehmenseigene Vorgehensweise, die auch in einer Hybridlösung bestehen kann.
Sobald die Rahmenparameter definiert sind, kann auf Basis der Anforderungen die Erstellung von Fachkonzepten beginnen, in denen die Zielprozesse klar und ausführlich beschrieben sind. Hier helfen Schaubilder zur Illustration und zur Schaffung eines tiefgehenden Verständnisses. Es ist essenziell sich damit auseinander zu setzen, in welcher Art und Weise die Prozesse abgebildet werden sollen. Dabei bietet sich die große Chance, Arbeitsabläufe zu verschlanken und auf Best Practice Ansätze zu wechseln. Häufig muss nicht jeder Schritt 1:1 übernommen werden.
Im Anschluss wird in einem technischen Konzept durch den Systemintegrator beschrieben, wie die Anforderungen durch das Customizing der Software abgedeckt werden. Fachbereich und Systemintegrator sollten aufgrund der Interdependenz zwischen Anforderung und Umsetzung eng zusammenarbeiten, da in manchen Systemen Standardprozesse mehr oder weniger out-of-the Box mitgeliefert werden. Dadurch besteht die Möglichkeit sowohl Implementierungs- als auch spätere Wartungskosten zu reduzieren.
Sowohl für die Definition der fachlichen als auch technischen Konzepte ist es von großer Wichtigkeit eine Abgrenzung zu den Anforderungen vorzunehmen, die nicht Teil der Implementierung sind, um einen realistischen und realisierbaren Aufgabenkatalog auf Basis des angesetzten Projektzeitraums festzulegen. Eine effiziente Methode, um eine Priorisierung und Kategorisierung aller Anforderungen auf Basis von Wichtigkeit und Auswirkung durchzuführen ist auch hier, wie bei der vorherigen Systemauswahl, die MSCW-Methode. Durch den Einbezug der beteiligten Stakeholder und der kollaborativen Einordnung in die entsprechenden Kategorien, entsteht eine gemeinsame und transparente Erwartungshaltung an das Projekt. Anforderungen, die nachträglich während des Implementierungszeitraums als projektrelevant eingestuft werden, sollten der gleichen Priorisierung unterzogen werden und haben gegebenenfalls zusätzliche Aufwände – sowohl ressourcen- als auch kostentechnisch – zur Folge.
Auf die erfolgreiche Abgrenzung der Projektaktivitäten folgt die tatsächliche Umsetzung und Einführung des Systems. Erfahrungsgemäß stellen sich Unternehmen an dieser Stelle die Frage nach dem richtigen Testvorgehen. Die Notwendigkeit eines dedizierten Testmanagements und der zugehörigen Dokumentation ist unumstritten. Projektverzögerungen wirken sich oft negativ auf die Testphase aus. Unzureichendes Testen kann zu schwerwiegenden Problemen führen, wie etwa falschen Buchungen, fehlerhaften Bewertungen, Zahlungsunfähigkeit oder Verstößen gegen Compliance-Richtlinien. Diese Beispiele zeigen, wie wichtig gründliches Testen ist, um große Auswirkungen zu vermeiden. Das moderne Testmanagement gilt als Möglichkeit, den bekannten Herausforderungen einer Systemimplementierung vorwegzugreifen, indem die bereits während des RfP festgelegten Anforderungen frühzeitig aufgegriffen und mit relevanten KPIs kombiniert werden, um maximale Transparenz zu schaffen.1 Dieses Vorgehen ermöglicht eine detaillierte sowie präzise Aufwandsschätzung für den Testdurchlauf. Ein Testmanagement-Tool ermöglicht darüber hinaus ein übersichtliches Fortschrittstracking, ein adressatengerechtes Reporting und dient gleichzeitig als Steuerungsgrundlage. Es ist zu empfehlen, das Vorgehen möglichst früh zu planen, um bei der folgenden Jahresabschlussprüfung ein umfängliches und auditkonformes Vorgehen nachweisen zu können, denn TMS-Systeme liefern wichtige Daten für ERP-Systeme und beeinflussen dadurch die Bilanzierung. Diese Relevanz sollte bei der Implementierungsplanung und der Audit-Compliance stets berücksichtigt werden. Eine projektbegleitende Prüfung (nach ISAE3000-Standard) kann Ihnen dabei helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen, diesen vorzubeugen und den Projekterfolg zu sichern.
Ein klassischer Aufwandstreiber in Implementierungsprojekten sind die Schnittstellen zu anderen Systemen – intern (z.B. Accounting) sowie extern (z.B. Zahlungsverkehr). Aus diesem Grund ist es wichtig, die bestehende IT-Architektur zu berücksichtigen und betroffene Abteilungen frühestmöglich in das Projekt einzubeziehen. Auch für die spätere Überführung in den Regelbetrieb ist es wichtig, die Verantwortlichkeiten insbesondere mit der IT-Abteilung zu klären, denn eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten ist notwendig, um den Betrieb effizient zu gestalten und Missverständnisse zu vermeiden.
Zusätzlich zur technischen und organisatorischen Planung ist auch das Change-Management ein zentraler Erfolgsfaktor. „Klare Rollenverteilungen und Kommunikationswege sorgen für eine effektive Umsetzung. Neben Fachwissen sind für die Teammitglieder Soft Skills wie Kommunikation und Problemlösungskompetenz entscheidend.“2 Dabei ist es sinnvoll, bestehende Mitarbeiter, Fähigkeiten, Rollenkonzepte und Verantwortlichkeiten zu integrieren und Wissen, insbesondere in Bezug auf das neue System und potenziell damit einhergehende Prozessänderungen, aufzubauen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die frühzeitige Einbindung aller zukünftigen Nutzer. Durch gezieltes Testing und Training werden die Nutzer mit dem neuen System vertraut gemacht. Eine umfassende Kommunikation ist entscheidend, um die Akzeptanz zu fördern und mögliche Widerstände zu adressieren. Diese methodische Herangehensweise gewährleistet nicht nur die technische Implementierung, sondern auch die nachhaltige Integration des Systems in die bestehenden Arbeitsprozesse.
Nach erfolgreichem Test und der Freigabe durch die relevanten Stakeholder ist es in Vorbereitung auf den Go Live des neuen TMS ratsam, diesen Prozess im Rahmen eines „Dress Rehearsals“ in einer Testumgebung durchzuführen, sodass die Zeitplanung überprüft sowie potenzielle Inkonsistenzen im Ablauf oder bei der Ausübung manueller Tätigkeiten aufgedeckt und behoben werden können. Des Weiteren sind alle Themen zu dokumentieren, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden können und nicht Go Live-relevant sind. Eine strukturierte Übergabe der offenen Punkte ermöglicht im Nachgang einen reibungslosen Betrieb bzw. priorisierte Abarbeitung dieser verbliebenen offenen Punkte. Dabei sollten Sie darauf achten, ein Umsetzungsdatum festzulegen, um eine vollständige und zeitnahe Durchführung zu gewährleisten.