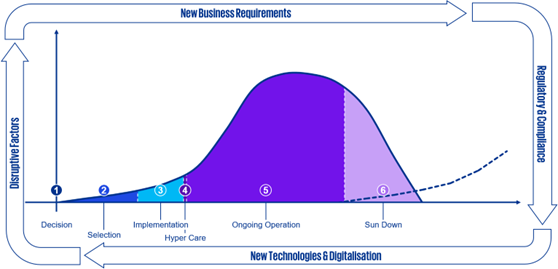Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, verschiedene Handlungsalternativen in Bezug auf das TMS zu evaluieren, gilt es den weiteren Auswahlprozess zu strukturieren und festzulegen, wer in diese Entscheidungen involviert werden sollte.
Zunächst sind die Anforderungen an das System oder den Systemanbieter selbst zu formulieren, um ein Fit-for-Purpose-System auszuwählen. Hier gilt es sowohl funktionale (z.B. Cash Management Aktivitäten) wie auch nicht-funktionale Aspekte (z.B. kommerzielle oder IT-spezifische Anforderungen) zu berücksichtigen. Es ist von essenzieller Bedeutung, diese Anforderungen möglichst vollständig und präzise zu formulieren. Zu knapp formulierte Anforderungen bergen das Risiko von Missverständnissen, z.B. ist die „Erfassung und Bearbeitung von Krediten“ sehr generisch und wird von den meisten Anbietern in mehr oder weniger sophistizierter Ausprägung angeboten. Besteht der Bedarf, komplexe Gebührenstrukturen, konditionale Kündigungsoptionen oder einen Marktwertausgleich bei frühzeitiger Rückzahlung abzubilden, sollte sich dies in den Requirements wiederfinden. Idealerweise und so weit antizipierbar, sollten auch zukünftige Anforderungen berücksichtigt werden, beispielsweise wenn neue Instrumente im Risiko-Management zum Einsatz kommen sollen oder das Unternehmen eine ESG-Strategie entwickelt, nach der künftige Geschäftspartner ein ESG-Rating auf einem bestimmten Niveau aufweisen müssen.
Neben der Treasury-Abteilung sollten die folgenden Abteilungen ihre Anforderungen an ein System oder einen Anbieter adressieren können: das Rechnungswesen (z.B. für die Verbuchung der mit den Treasury Aktivitäten einhergehenden Geschäftsvorfälle), die HR-Abteilung (z.B. für die Abwicklung von HR-Zahlungen), die IT-Abteilung (z.B. für die Berücksichtigung von strategischen Partnerschaften oder für Schnittstellen zur Einbettung in die Gesamt-Unternehmens-IT-Landschaft), das Controlling (z.B. für die Übernahme von Plandaten) oder die Compliance-Abteilung (z.B. für die Erstellung von AWV-Meldungen). Sind die Anforderungen aller potenziellen Anspruchsgruppen berücksichtigt, müssen diese priorisiert bzw. gewichtet werden, um sicherzustellen, dass essenzielle Anforderungen nicht unter- und wenig wertstiftende Anforderungen nicht überbewertet werden. Einen Ansatz bietet hier die MSCW-Methode, bei der die Anforderungen in vier Gruppen eingeteilt werden: Must (Anforderungen, die in jedem Fall erfüllt sein sollten), Should (ebenfalls wichtige Anforderungen, die aber nicht oberste Priorität besitzen), Could (sogenannte Nice-to-Have-Kriterien, deren fehlende Abdeckung keinen entscheidenden Nachteil bedeuten) und Won’t (Kriterien die voraussichtlich nicht erfüllt werden, was sich aber nicht auf den Nutzen bzw. die Akzeptanz auswirkt).
Auf Basis der definierten Kriterien erfolgt im nächsten Schritt eine erste Analyse des Anbieter- und Lösungsmarktes. Hier sind neben der Validierung der im Unternehmen vorhandenen Kenntnisse auch der Austausch mit anderen Treasurern, einschlägige Marktanalysen (z.B. von Gartner oder Forrester), Recherche im Internet und in Fachpublikationen (z.B. Der Treasurer) sowie externes Expertenwissen als Quelle heranzuziehen. Das Resultat ist eine „Market List“. An dieser Stelle können bereits erste, übergreifende Filterkriterien verwendet werden, z.B. der grundsätzliche Funktionsumfang, der Komplexitätsgrad oder die Größe des Herstellers, um den weiteren Auswahlprozess möglichst effizient zu gestalten. Nach dieser groben Filterung erhält man eine „Longlist“.
Anschließend ist diese Longlist durch Anwendung individueller Anforderungskriterien auf eine „Shortlist“ zu reduzieren. Diese sollte im Idealfall zwei bis fünf Systeme enthalten. Wenn die Kriterien hinreichend detailliert sind und die Informationen zu ihrer Erfüllung frei verfügbar sind, kann die Shortlist gegebenenfalls direkt nach der Marktanalyse erstellt werden. Alternativ kann auf objektives Expertenwissen zurückgegriffen werden.
In einem Ausschreibungsverfahren (Request for Proposal), das auf den eingangs formulierten Anforderungen basiert, sind entsprechende Unterlagen zu erstellen, die neben der Spezifikation auch Informationen zum Unternehmen selbst, zum weiteren Prozess, einen Zeitplan zur Beantwortung der Fragen, und andere Angaben enthält. An dieser Stelle sollten – wenn nicht bereits geschehen – die Einkaufsabteilung und die Rechtsabteilung eingebunden werden, um den Prozess zu organisieren, die Grundlagen für eine spätere zielgerichtete Verhandlung zu legen und sicherzustellen, dass rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt sind. Die Ausschreibungsunterlagen werden an die Anbieter versandt und häufig wird die Möglichkeit eingeräumt, Fragen zu platzieren, deren Antworten mit allen Teilnehmern geteilt werden können. Es empfiehlt sich, die Ausschreibungsunterlagen derart auszugestalten, dass die Antworten effizient ausgewertet werden können. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Erfüllung der Anforderungen von den Anbietern oft sehr optimistisch eingeschätzt wird. Hier bietet Hands-On-Expertenwissen einen großen Mehrwert. Auf Basis der Antworten ist der Abdeckungsgrad der am Anfang gewichteten Anforderungen zu bewerten.
Häufig verbleiben zwei bis drei Systeme in der engeren Auswahl, die dann zu einem sogenannten „Beauty Contest“ eingeladen werden, zu dessen Vorbereitung verschiedene, essenzielle End-to-End Use Cases definiert werden, z.B. vom Empfang eines Kontoauszuges über den Abgleich mit Forecasts, gegebenenfalls mit manueller Nachbearbeitung, über die Verbuchung bis hin zur Erstellung eines Tagesfinanzstatus. Der Eindruck zur Präsentation kann ebenfalls in die Bewertung einfließen. Gegebenenfalls finden parallel oder im Anschluss weitere Vertragsverhandlungen statt, um das kommerzielle Angebot zu optimieren.
Unter Berücksichtigung aller Parameter ist das objektiv beste System auszuwählen und gegenbenenfalls ein Systemintegrator, wenn die Leistung nicht vollständig von den Treasury- und IT-Abteilungen sowie dem Systemanbieter erbracht werden kann. In diesem Kontext sind die entsprechenden Verträge zu unterzeichnen.